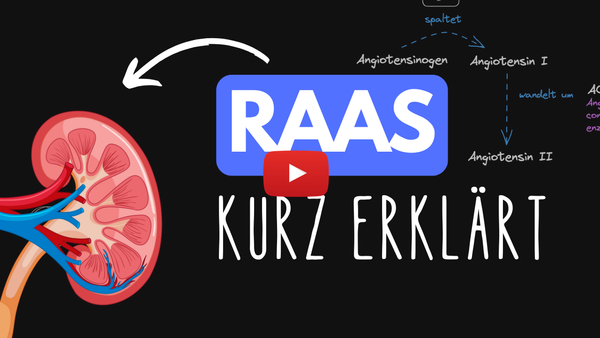Folge 05: Schultergelenkmuskulatur
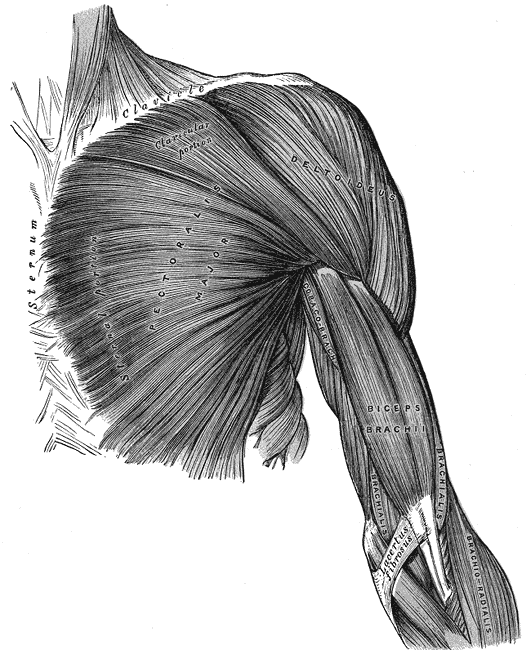
Die Schultergelenkmuskulatur wird in eine dorsale und eine ventrale Muskelgruppe unterteilt, die alle am Oberarmknochen inserieren.
4 Muskeln der dorsalen Muskelgruppe bilden die sog. Rotatorenmanschette (M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. teres minor, M. subscapularis). Diese wird in einer eigenen Folge behandelt.
- M. supraspinatus
- M. infraspinatus
- M. teres minor
- M. subscapularis
Muskeln der dorsalen Gruppe in dieser Folge sind der:
- M. deltoideus
- M. teres major
- M. latissimus dorsi.
Zur ventralen Muskelgruppe gehören:
- M. pectoralis major
- M. coracobrachialis.
Dorsale Gruppe
M. deltoideus, M. teres major, M. latissimus dorsi
M. deltoideus
Der Musculus deltoideus, auch kurz Deltoideus oder Deltamuskel genannt, ist ein dreieckiger Skelettmuskel. Er liegt wie ein Paket über dem Schultergelenk und verleiht ihm Halt, indem er den Kopf des Oberarmknochens in die Gelenkpfanne drückt. Der Musculus deltoideus ist wesentlich an der Kontur der Schulterregion beteiligt und dient der Hebung des Oberarms.
Anteile
Der Deltamuskel lässt sich beim Menschen in drei Teile untergliedern:
- Pars clavicularis (Schlüsselbeinteil; „vorderer Deltamuskel“)
- Pars acromialis (Schulterhöhenteil; „mittlerer Deltamuskel“)
- Pars spinalis (Grätenteil; „hinterer Deltamuskel“)
Funktion
Nach initialer Abduktion des Armes um ca. 10 Grad durch den Musculus supraspinatus zieht der Deltoideus mit seinen mittleren Fasern (pars acromialis) den Arm bis ungefähr 60 Grad nach oben, bevor er aktiv insuffizient wird. Nun erreichen jedoch die gefiederten Anteile (Pars clavicularis und spinalis) ihre benötigte Hubhöhe und können den Arm somit weiter abduzieren und über 90 Grad heben. Für das Heben des Armes über die Horizontale (Elevation) ist eine Rotation des Schulterblattes nötig, da der Arm ansonsten gegen das Schulterdach stößt. Die vorderen Fasern ziehen den Arm zusätzlich nach vorne (Flexion oder Anteversion) und drehen ihn nach innen (medial), die hinteren Fasern hingegen ziehen den Arm nach hinten (Extension oder Retroversion), und drehen ihn nach außen (lateral).
Klinik
Der Musculus deltoideus wird aufgrund seiner Lage (große Entfernung zu Nerven oder Arterien) zur intramuskulären Injektion von Medikamenten genutzt. Bei einer Lähmung des Nervus axillaris fällt der Musculus deltoideus als stärkster Abduktor im Schultergelenk aus und das Anheben der Arme ist stark vermindert.
M. teres major
Der Musculus teres major (lat. für „großer runder Muskel“) befindet sich auf der Rückseite des Körpers und ist an der Bildung der Achsellücken beteiligt.
Über eine gemeinsame Endsehne mit dem Musculus latissimus dorsi, zieht er durch die Achselhöhle zur Vorderseite des Oberarmknochens. Zwischen dieser Sehne und dem Knochen liegt ein Schleimbeutel (Bursa subtendinea), welche als Gleitlager beim Heranführen des Armes dient. Dabei liegt der Musculus teres major kranial des Musculus latissimus dorsi.
Funktion
Durch den Verlauf kann der Muskel den Arm nach innen drehen (Innenrotation), nach hinten ziehen (Retroversion) und wenn der Arm vom Körper seitlich wegbewegt wurde ihn wieder an den Körper heranziehen (Adduktion).
Innervation
Der Musculus teres major wird vom Nervus thoracodorsalis und/oder vom Nervus subscapularis, selten auch vom Nervus axillaris innerviert.
Musculus latissimus dorsi
Der Musculus latissimus dorsi (lat. für „breitester Rückenmuskel) liegt auf der ganzen Länge der Wirbelsäule unterhalb des Schulterblatts (Scapula) und endet am oberen Beckenrand. Er wird teilweise vom Trapezmuskel überdeckt.
Der Musculus latissimus dorsi hat seinen Ursprung am Rumpf. Er zieht sich vom Kreuz- und Darmbein über die Dornfortsätze der Lenden- und Brustwirbel durch die Achselhöhle zum Oberarm. Dabei bildet er mit dem vorderen Sägezahnmuskel ein markantes Muster. Der M. latissimus dorsi ist der flächengrößte Muskel des Menschen. An seiner Innenseite verlaufen Arteria, Vena und Nervus thoracodorsalis.
Anteile
Der Muskel hat vier Teile:
- Pars vertebralis (Wirbelsäulenteil)
- Pars costalis (Rippenanteil)
- Pars iliaca (Darmbeinanteil)
- Pars scapularis (Schulterblattanteil)
Funktion
Der Musculus latissimus dorsi dreht den Arm auf den Rücken, wobei die Handfläche nach außen zeigt, z. B. wenn die Hand an das Gesäß geführt wird. Aus diesem Grunde wird er auch „Schürzenbindermuskel“ genannt. Er entfaltet seine Hauptwirkung bei angehobenen Armen, die er senken kann oder zum Beispiel bei Klimmzügen den Rumpf nach oben ziehen kann. Er ist damit der Antagonist des Musculus deltoideus und des Trapezmuskels. Mit dem Musculus teres major bildet er die hintere Achselfalte.
Der Muskel spielt eine synergetische Rolle bei der Streckung und Seitwärtsbeugung der Lendenwirbelsäule. Er hilft bei der gepressten Ausatmung (vordere Fasern) und auch als Atemhilfsmuskel bei der Einatmung (hintere Fasern).[1]
Als Teil der exspiratorischen Atemhilfsmuskulatur unterstützt der Musculus latissimus dorsi („Hustenmuskel“) beim heftigen Atmen die Entleerung der Lunge.
Ventrale Gruppe
M. pectoralis major, M. coracobrachialis
M. pectoralis major
Der Musculus pectoralis major (lat. für „größerer Brustmuskel“) bedeckt den gesamten vorderen Rippenbereich.
Am Oberarm überschneiden sich die Fasern des Musculus pectoralis major: Die Fasern, die von weit unten kommen, setzen weiter oben an als die Fasern, die vom Schlüsselbein kommen. Dadurch entsteht ein Bogen, der die vordere Begrenzung der Achselhöhle bildet. Der Musculus pectoralis major bedeckt den kleinen Brustmuskel (Musculus pectoralis minor). Außen liegt ihm die Brustfaszie an, welche ihn von der oberflächlichen Schicht der Brustwand trennt.
Der große Brustmuskel besteht aus drei Teilen:
- Pars clavicularis (Schlüsselbeinteil)
- Pars sternocostalis (Brustbein-Rippen-Teil)
- Pars abdominalis (Bauchteil)
Funktion
Der Musculus pectoralis major zieht den Arm zum Körper (Adduktion), dreht ihn nach innen (Innenrotation) und zieht ihn nach vorne (Anteversion). Außerdem gehört er zur Atemhilfsmuskulatur. Abhängig von der Position des Oberarms verändert der Pectoralis jedoch seine Funktion. Er führt den Arm aus einer Anteversionsstellung zurück (Retroversion)[1]
Innervation
Der Musculus pectoralis major wird vom Nervus pectoralis lateralis und vom Nervus pectoralis medialis innerviert.
M. coracobrachialis
Der Musculus coracobrachialis (lat. für „Hakenarmmuskel“) ist einer der Skelettmuskeln des Oberarms. Er entspringt gemeinsam mit dem kurzen Kopf des Musculus biceps brachii und ist in seinem proximalen Teil mit ihm verwachsen. Durch den Muskel tritt der Nervus musculocutaneus. Bei erhobenem Arm wird der Muskel durch die Haut sichtbar und führt an seiner Innenseite die Gefäß-Nerven-Straße des Oberarms.
Funktion
Die Hauptfunktion des Musculus coracobrachialis ist die Fixierung des Oberarmknochens in der Schultergelenkpfanne. Seine weiteren Funktionen sind Adduktion (zum Körper ziehen), Anteversion (nach vorne ziehen) und Innenrotation des Armes.